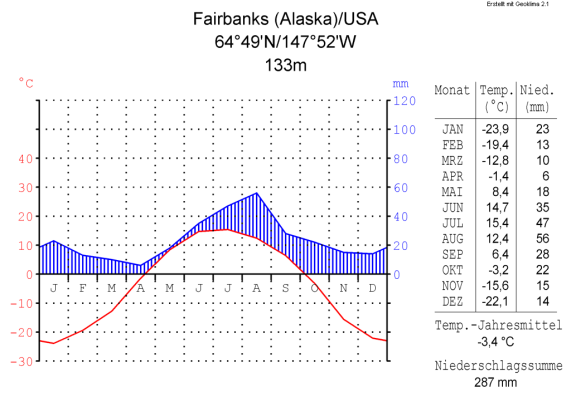Heute habe ich meinen Kilometerrekord geschafft: 769! Von Chistochina am Glenn Highway bis nach Whitehorse in Kanada. Rund 80 Kilometer mit dem Rad, den Rest mit einem dieser Riesentrucks.
Nach kalter Nacht und warmem Frühstück fahre ich bei schönstem Wetter los. Wegen der Kälte vergesse ich, mir die Hände und die Waden mit Sonnencreme einzuschmieren. Das rächt sich. Bereits nach zwei Stunden merke ich den Fehler.
Ich ziehe mir die lange Hose und die dicken Handschuhe an. Aber auch das verdirbt mir meine Laune nicht – die Weite dieser Landschaft ist unvergleichlich.
Ein Berg in der Ferne wirkt wie ein Spoiler: Die warme Luft aus Osten wird nach oben abgelenkt, sie kondensiert in den oberen Schichten und es bildet sich ein Schweif über dem Berg. Einzigartiges Naturschauspiel. In solchen Momenten bin ich froh, das Fahrrad als Verkehrsmittel gewählt zu haben: Ich kann meine Klamotten dranhängen, habe ein Tempo, das mich ausreichend schnell für die Reiseziele und ausreichend langsam für die Natur sein lässt. Ich bin den Elementen direkt ausgesetzt und kann den Wechsel von Tageszeiten und Landschaften stetig beobachten.
<>
Irgendwann höre ich ein ungutes Knallgeräusch hinter mir. Als hätte jemand ein unter Spannung stehendes Stahlseil durchgeschnitten. Ich fühle, dass die Hinterradbremse bei jeder Radumdrehung einmal kurz an der Felge schleift. Scheibenkleister – Speichenbruch.
“Macht nochmal eine Inspektion” sagte ich kurz vor der Abreise zu meinem Radhändler. Die Räder seien gut ausgewuchtet und zentriert, sagten sie. Die Rohloff-Nabe würde ja dafür sorgen, dass die Räder symmetrisch eingespeicht werden und damit ein Speichenbruch absolut unwahrscheinlich wäre.
Das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Bis Tok sind es noch rund 60 Kilometer und das ist der nächste Ort. Wenn ich weiterfahre, knallt bald die nächste Speiche, da das komplette Hinterradsystem auf sich ausgleichende Spannungen ausgelegt ist.
Ich lerne, dass es nicht reicht, einfach nur eine Ersatzspeiche mitzunehmen sondern auch einen passenden Nippel, da die Speiche direkt im Nippel gebrochen ist und ich den Rest da nicht rauskriege. Ursache für den Speichenbruch genau im Nippel ist die Tatsache, dass ich zwar mit meinen 26-Zoll-Rädern sehr stabile Räder habe, aber durch den großen Durchmesser der Rohloff-Nabe ist die Entfernung zwischen Nabenflansch und Felge so gering, dass die Speichen bereits im Nippel an der Felge beginnen, sich nach der Nabe auszurichten. Das führt zur Sollbruchstelle für die Speiche.
Hinterher erfahre ich von Riese und Müller, dass das konstruktiv durchaus nachvollziehbar sei und eine Felge mit schräg gebohrten Nippel-Löchern die bessere Wahl sei. Echt klasse! Da bauen die Fahrräder für die Weltreise, kommen durch Nachdenken auf gute Lösungen, setzen sie aber nicht um.
Genau vier Speichen neben der gebrochenen klebt ein Schild auf der Felge: “Handcraftet by Riese und Müller Wheel Team”. Meine Wut wächst. Denen werde ich was erzählen…
Aber all der Ärger hilft mir jetzt nicht weiter. Ich fahre mit meinem Rad weiter bis zum nächsten Parkplatz direkt am Highway.
Das Glück ist mit den Radlern: Auf dem Parkplatz steht so ein Riesenmonstrum von Lastwagen mit einem leeren Auflieger – eine einfache Holzpritsche mit drei Achsen drunter.
Der Fahrer sitzt in seinem Führerhaus und liest Zeitung.
Fragen kostet nix, ich klopfe an. Die Tür öffnet sich und ein freundliches männliches Gesicht mittleren Alters mit langen Haaren drüber schaut zu mir runter. Na ja – die Brille ist so dick und verschmiert, dass ich nicht weiß, ob der Mann wirklich erkennt, wer da unten steht.
Ich erzähle von meinem Missgeschick und frage ob ich bis Tok mitfahren könne.
Auf dem Land und in der Wildnis Alaskas sind die Menschen gegenseitig auf Hilfe angewiesen – niemand wird abgewiesen, wenn es nicht wirklich einen triftigen Grund gibt. Und so scheint es selbstverständlich, dass der Trucker aussteigt, sich mein Gefährt anschaut und mir den Anhänger anbietet, nicht ohne vorher zu kommentieren: “There’s nothing more you can put on that bike, eh?”
Ich binde Zelt, Schlafsack und Isomatte los, hänge die Packtaschen ab, und wuchte das Interconti hoch zu Randy, der es in der Mitte des Trailers auf die Seite legt, ein paar Zurrgurte drumwickelt und deren Enden dann irgendwo am Rand der Ladefläche festzieht. Runterfallen kann mein Rad jetzt jedenfalls nicht mehr.
Mein Gepäck verfrachte ich in die Kabine und klettere auf den Beifahrersitz.
Meine Güte, ist das groß hier! Ich schätze die Höhe der Kabine auf gut zwei Meter und hinter mir ist noch ein Schlafzimmer mit Doppelstockbett. Es sieht zwar aus wie Kraut und Rüben, aber dennoch wird dadurch die Großzügigkeit des Innenraums nicht beeinträchtigt.
Randy startet den Motor, mein Sitz vibriert nicht, er schüttelt sich. Randy sieht aus wie fünfzig, ist aber erst kurz über vierzig und schon zweifacher Großvater. Stolz erzählt er von seinen beiden Enkeltöchtern. Seine Familie lebt irgendwo in Montana, er arbeitet für eine Spedition in Anchorage, Alaska und muss jetzt nach Las Vegas, Nevada, um dort eine Maschine abzuholen und sie nach Fairbanks, wieder Alaska, zu bringen. Meist ist er sieben Tage die Woche unterwegs, sieht seine Familie kaum. Und das für “Sixty K Bucks” – 60 Tausend Dollar.
Mein Glück ist, dass fast alle Trucks leer in Richtung Süden fahren, da in Alaska nichts produziert wird, was in den Lower States, in Kontinental-USA, verkauft werden könnte. Fische bringt man nicht erst in Alaska an Land sondern schippert sie direkt nach San Francisco oder Los Angeles. Und Alaska lebt nun mal vom Erdöl, was per Supertanker transportiert wird.
Randy schätzt, dass er drei Tage nach Las Vegas braucht. Der Alcan Highway ist jetzt im Frühjahr schlaglochzersetzt und da könne er den Fuß nicht immer auf dem Gaspedal stehen lassen. Er hat noch einen älteren Truck und fährt ohne Navi und Tempomat – das bringt mehr Gefühl für das Gefährt und die Straße, sagt er.
Was ich denn in Tok wolle, fragt er. “Spokes and nipples”, antworte ich.
Randy lacht und klärt mich auf: Das was ich mit “Nippel” meine, sei wahrscheinlich ein “fitting” – für “nipples” kenne er nur eine Bedeutung und die erinnere ihn eher an weiche Rundungen als an spitze Speichen und harte Felgen.
OK – daran habe ich irgendwie schon lange nicht mehr gedacht…
“Warst Du schon mal in Tok?” reißt er mich aus meinen Gedanken.
“Bisher noch nicht.”
“Dort können sie Dir an einer Tankstelle vielleicht Speiche und Nippel wieder zusammenschweißen, aber einen Fahrradladen gibt’s da nicht.”
“Und wo ist der nächste Fahrradladen?”
“In Whitehorse.”
Whitehorse – das ist doch die Zwischenlandungsstation vom Hinflug, mitten in Yukon. Von dort bin ich noch zwei Stunden geflogen bis Anchorage. Das müssen also noch rund tausend Kilometer sein. Eigentlich wollte ich Rad fahren.
“Fährst Du da hin?”
“Ja, will dort übernachten.”
“Nimmst Du mich mit?”
“Ja – nur müssen wir uns an der Grenze nach Kanada noch was überlegen.”
“Warum?”
“Die stellen sich immer ziemlich pingelig an wegen der Zollformalitäten. Wenn ich Dein Rad hinten drauf lasse, muss ich Einfuhrzoll bezahlen.”
“Hmm…”
“Kein Problem: Ich halte kurz vor der Grenze an, wir laden das Rad ab, fahren getrennt über die Grenze, hinter der Grenze warte ich auf Dich, wir laden das Teil wieder auf und fahren nach Whitehorse.”
OK. Ich bin froh, dass das geregelt ist. Randy ist total nett und wir haben interessante Gespräche. Auch wenn er Jäger und Fallensteller ist, interessiere ich mich für seine Art zu leben. Jagen und Angeln ist hier ein Stück Kultur. Die Natur bietet einen reichen Schatz – “There’s so much!”.
Mit einer Diskussion über Ethik, Sinn und Unsinn von Jagden brauche ich gar nicht erst anfangen. Und Randy vermittelt mir ein Gefühl von Ehrfurcht vor der Natur, ihren Geschöpfen und vor dem was er tut. Früher waren wir doch auch Jäger – reduziert auf krude Triebe gibt es zwischen den Spezien nun mal nur Jäger und Gejagte. Schließlich könne er doch in der Wildnis auch schnell zum Gejagten werden, wenn er Bären begegnet.
Während er die Reisegeschwindigkeit zwischen 120 und 130 km/h hält, schaue ich immer mal wieder in den Rückspiegel – kann mein Gefährt gut erkennen. Highways in Alaska und Kanada haben die Eigenschaft, dass sie manchmal plötzlich Gravelroads sind – Schotterstraßen. Das hat mit dem Permafrostboden zu tun. Wenn der Winter an einigen Stellen zu hart an den Straßen arbeitet, lohnt sich eine Asphaltdecke nicht, da diese einfach zerspringt, platzt und Riesenstücke entstehen, die von den Trucks rausgerissen werden.
Da kommen dann eben im Frühjahr die Gravel-Maschinen, streuen Schotter und walzen den fest. Das funktioniert ganz gut. Hier oben fährt ja auch fast jeder irgendwelche Geländekisten, Pickups oder Trucks. Und ich ein vollgefedertes Interconti. Wenn es denn funktioniert.
Auf den Schotterstücken sehe ich im Rückspiegel nichts mehr – das heißt: Außer Staub nichts mehr.
Die Schlaglöcher, die jetzt schön tief sind, halten Randy nicht vom “Cruisen” ab. Wenn er ihnen nicht ausweichen kann, fährt er einfach drüber. So ein Truck ist ja aus fahrtechnischen Gründen kaum gefedert. Was das Fahrwerk nicht schluckt, muss der Sitz ausgleichen. Der Fahrersitz bewegt sich irgendwie eliptisch vor, zurück, hoch und runter. Das ist ein echtes Meisterwerk, Randy schaukelt beruhigend vor seinem riesigen Lenkrad. Der Beifahrersitz bewegt sich auch. Aber nur hoch und runter. Das Schlagloch kommt, der Truck erhält einen Mordsschlag. Mein Sitz wird nach unten gedrückt, der Gasdruckdämpfer im Sitzfuß wird zusammengepresst und dehnt sich sofort wieder aus. Das schleudert mich nach oben und ich weiß jetzt, warum die Kabine so hoch ist.
Die Grenze zu Kanada passieren wir gegen 21 Uhr. Wir machen es wie besprochen. Ich fahre getrennt von Randy, lasse mir den Ausreisestempel in meinen Reisepass eintragen und schiebe das Rad noch 200 Meter zu dem wartenden Truck. Die Zöllner beobachten das gelassen – formal ist doch alles geregelt.
Eine Einladung zu einem Abendessen in ein Trucker-Restaurant am Highway überrascht meinen Chauffeur. Sowas wäre doch gar nicht nötig. Ich bestehe auf meiner Einladung und so essen wir bei Burwash Landing die obligatorischen Hamburger und trinken Kaffee.
Hier sehe ich auch die ersten Grizzlys am Straßenrand – es seien keine Cubs, keine kleinen mehr, sondern geschätzte drei bis vier Jahre alt, meint Randy. Sie streunern rum auf der Suche nach Nahrung.
Ein Bär hat letztlich drei Hauptaufgaben: Fressen, schlafen, fortpflanzen. Die ersten beiden beschäftigen ihn zu mehr als 90% seiner Lebenszeit. Und Menschen stehen auf dem Speiseplan. Randy erklärt, dass wir zwar erst an zehnter oder elfter Stelle kämen, nach so leckeren Speisen wie Fisch, Beeren oder frisches Gras. Aber manchmal sehnen sich auch Bären nach Abwechslung beim Essen. Und dann wird’s gefährlich.
Um 2 Uhr kommen wir in Whitehorse an. Auf der Tankstelle an der Hauptstraße verabschiede ich mich von Randy, gebe ihm meine Email-Adresse und weiß, dass er nicht schreiben wird.
Das sind Begegnungen, die einmalig sind. So einmalig wie die Menschen und die Natur hier. Auf der ganzen Fahrt habe ich nicht ein einziges Mal daran gedacht, ein Foto von Randy oder seinem Truck zu schießen – es hätte einfach nicht gepasst, etwas von der Harmonie gestört, die sich zwischen uns aufbaute. Am Ende waren wir beide dankbar: Er hatte 700 Kilometer Abwechslung und ich letztlich auch. Dass mein Radtransport da zur Nebensache wird, überrascht mich. Wieder Glücksgefühle. Deshalb bin ich unterwegs.
Mein Rad hat die Tortur auf dem ungefederten Trailer überlebt, nur ist es nicht mehr schwarz sondern grau vom Staub.
Ich suche mir einen Zeltplatz. Das ist hier einfach, da es nachts nicht dunkel wird. Der Himmel glüht im Norden, das ist ein irres Gefühl. Ich werde irgendwann mal nachts aufbleiben und fotografieren – die ‘Nacht’ dauert ja nur zwei Stunden.
Im Zelt liegend merke ich jetzt erst, wie müde ich eigentlich bin. Zufrieden und glücklich schlafe ich ein.